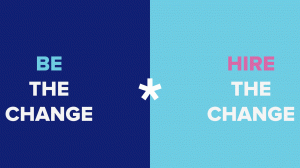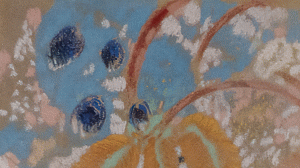Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel darüber gesprochen, dass Perfektionismus nicht gerade eine der glücklichsten Kurven ist, die wir in unserer Persönlichkeitsentwicklung nehmen. Perfektionismus ist eine dieser Bewältigungsstrategien, die es eigentlich gut meint, denn wir haben erlebt: „Fehler dürfen nicht sein, sonst werde ich beschämt und sanktioniert“ und schlussfolgerten, dass es wohl möglich sein müsse, keine Fehler zu machen, sonst wäre es ja unlogisch, Fehler zu bestrafen. Es müsse also an uns selbst liegen und wir müssten uns einfach richtig, richtig viel Mühe geben, um endlich tadellos zu werden. Aber es hilft kein Leugnen: Das Streben nach steter, vollkommener Spitzenleistung als unterste Messlatte festzulegen, übersetzt sich für die meisten gar nicht in Erfolg. Vielmehr führt Perfektionismus oft schlicht zu Prokrastination – denn wenn wir Aufgaben vermeiden, können wir nichts falsch machen, richtig? Logisch.
Und was wenn’s doch klappt, wenn wir doch Erfolg haben? Der südkoreanische Rapper Psy, der 2013 mit seinem Song „Gangnam Style“ einen rekordbrechenden, internationalen Mega-Hit landete, bezeichnete diese Errungenschaft in einem Interview auch als „Albtraum“, denn wie solle er sie mit dem nächsten Song toppen? Ihm war wohl klar (und sollte damit Recht behalten), dass das nicht gelingen würde, aber das hat ihn nicht daran gehindert, sich diesen Druck nach höher, schneller, weiter einzuverleiben. Perfektionismus macht, dass wir nicht mal unsere Erfolge uneingeschränkt genießen, mit ihnen zufrieden sein zu können.
Und: Perfektionismus macht uns auch einfach unehrlich. In einer Gesellschaft, in der unser Wert als Mensch an der Exzellenz unserer Leistung gemessen wird und in der Fehler nicht vorgesehen sind, ist es schlicht menschlich und naheliegend, es zu leugnen, sobald uns Fehler passieren. Und oft steckt nicht mal Mutwilligkeit dahinter. Unsere Sozialisation: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und so erzählen wir uns „White Lies“. Eine weiße Lüge ist z.B. eine Aufgabe zu übernehmen, obwohl ein Anteil in uns weiß oder wissen könnte, dass das unsere zeitlichen Kapazitäten sprengen würde – aber wir erlauben uns nicht, abzulehnen oder outzusourcen. Weil wir denken, wir müssten Ja sagen, tun wir es und versichern uns im völlig unbegründeten und unrealistischen Optimismus, das noch irgendwo dazwischen quetschen zu können.
Viele von uns müssen noch lernen, dass es für Perfektion keinen echten, verlässlichen Maßstab gibt, sondern es häufig einfach einer Entscheidung bedarf um z.B. eine Aufgabe als vollbracht zu markieren und sie abzuschließen. Denn wenn wir ehrlich sind, gäbe es IMMER noch etwas zu ergänzen, noch etwas zu recherchieren, noch etwas zu polieren. Die Entscheidung „gut genug“ ist also das Gebot der Stunde. Aber… wie wissen wir, was gut genug ist? Ich habe schon mal darüber geschrieben, dass die Messlatte für das, was als gut genug gilt, wessen Leistung als wertvoll und wichtig gilt und wessen nicht, nicht für alle Menschen gleich ist – sie sieht für marginalisierte Personengruppen anders aus als für privilegierte Personengruppen.
Und… was ist, wenn wir nicht nur anstreben, Perfektionismus zu überwinden, sondern auch dieses völlig undefinierte und willkürliche „gut genug“…?
Wollen wir mal über die entzerrende Option reden, mittelmäßige Leistung zu normalisieren?
Freilich: Für einige Personengruppen ist das längst normal, wir reden bloß selten drüber – und sie kommen auch noch damit durch! Die Redakteurin Elsa Koester hat darauf mal in einem Tweet hingewiesen, sie schreibt:
Zitat: „Ich habe es so satt, superkluge Autorinnen überreden zu müssen, Texte zu schreiben, die dann doch absagen, weil sie verantwortungsbewusst mit viel Zeit richtig gut schreiben wollen – mit dem Ergebnis, dass ich dann einen Typen frage, der den Text in 2 Stunden aufs Blatt klatscht. Viele Autorinnen haben die Care-Arbeit am Hals, in der Pandemie um so mehr, plus eine größere Unsicherheit, gepaart mit dem Anspruch, es richtig gut zu machen. Ergebnis: Autorinnen sagen mir wesentlich häufiger ab als Autoren. […] Frage ich einen Mann, gibt es fast immer eine Zusage, und wenn der eigentlich keine Zeit hat, sagt er es nicht, sondern man merkt es bloß dem Text an, dass da Hektik im Spiel war. Der Inhalt enttäuscht dann zwar, aber hey: immerhin ist meine Seite voll!“
Nicht falsch verstehen, das Patriarchat ist kein Vorbild für meinen Feminismus. Emanzipatorische Prozesse will ich intersektional und privilegiensensibel, ich will nicht, dass wir Frauen uns patriarchales Entitlement erkämpfen – ich will, dass wir das große Ganze im Blick behalten und üben, weich und fürsorglich mit uns und einander zu sein.
Das ist wichtig, weil diese patriarchalen, kapitalistischen, klassistischen Dominanzhierarchien
so wirkmächtig sind, haben wir Hochleistungsdenken nicht nur für die Lohnarbeitswelt verinnerlicht, sondern sie haben sich auch längst unserer Freizeit und unserer Körper bemächtigt. Wenn wir neben der Lohnarbeit überhaupt Zeit für Hobbys wie Kunst, Musik oder Handarbeit finden, ist der Anspruch zunehmend höher, als sie einfach nur für Spaß, Entspannung und persönlichen kreativen Ausdruck zu betreiben – wer weiß, vielleicht ließe sich das Hobby sogar monetarisieren, wenn man es nur „gut genug“ lernen würde…?
Und wenn Frauen kürzlich ein Baby geboren haben, ist es nicht „gut genug“, wenn man das unserem Körper ansieht; und wenn wir müde sind, sehen wir nicht „gut genug“ aus, wenn sich das in unserem Gesicht zeigt. Nicht gelernt zu haben, zufrieden mit uns zu sein, hat längst auf alle möglichen Lebensbereiche übergegriffen.
Und deshalb: Mut zur Mittelmäßigkeit! Das muss ja keine absolute Angelegenheit sein, das kann sich ja auch auf Teilleistungen beziehen. Zu meinen Stärken gehört z.B. Out-of-the-Box-Thinking oder ziemlich gut schreiben und reden zu können, und mir fällt idR kein Grund ein, nervös zu sein bevor ich vor Menschen spreche. Was (gelinde gesagt) nicht zu meinen Stärken gehört: Zeitmanagement. Im neurodivergenten Spektrum bin ich u.a. dort angesiedelt, wo keine an die Realität angedockte Beziehung zu Zeit existiert. So bin ich mir ziemlich sicher, dass ich noch kein einziges Mal meine Kolumne Deadline-gerecht abgegeben habe, und für fast jede Kolumne habe ich – natürlich auf den letzten Drücker – mindestens einen kompletten Nachtschlaf geskippt. Und jetzt, da sich mein Jahr als Kolumnistin dem Ende neigt, wird mir klar, dass ich mir so viel Druck und Scham, und meinen Kolleg*innen den Stress, den eine verspätete Abgabe in ihrem Schedule verursacht, hätte ersparen können. Ich hätte dafür „nur“ mein Unvermögen, an dieser spezifischen Stelle ein Leistungslevel zu erbringen, das nicht nur unperfekt, sondern nicht mal „früh genug“ ist, zeitig und ehrlich in Kontakt bringen können: „Lasst uns mal die Deadline zwei-drei Tage nach vorne schieben, sonst wird das nix bei mir.“. Stattdessen habe ich mir allmonatlich die weiße Lüge erzählt: „Nächsten Monat fange ich einfach früher an!“
Vortreffliche Texte und komplett kümmerliches Zeitgefühl treffen sich doch im Ergebnis irgendwie in einer extrem okayen Mittelmäßigkeit – für die sich ja in diesem Fall eine recht einfache Lösung hätte finden lassen können…!
Die Generation Z hat davon aber natürlich längst eine fancy Variante entwickelt: Quiet Quitting (Stille Kündigung) oder auch Acting your Wage (sich dem Gehalt angemessen verhalten). Auf TikTok gehen diese Ideen viral, nach denen sich junge Menschen von einer Lohnarbeitsmentalität verabschieden, die das Leben vereinnahmt und Workaholism und die Priorisierung der beruflichen Karriere glorifiziert. Quiet Quitter*innen machen pünktlich Feierabend und nehmen sich gewissenhaft ihre Pausen und Urlaubstage. Sie würden nie auf die Idee kommen, sich krank zur Arbeit zu schleppen und erledigen den vertraglich vereinbarten Workload auf Basis des Bare Minimums – nicht mehr, nicht weniger. Sie fallen nicht auf Stellenanzeigen rein, die erwarten, dass man leidenschaftlich für den Job brennt – weil sie wissen, dass das vor allem darauf hinauslaufen soll, sich persönlich mit dem Job zu identifizieren, um aus einem kruden Arbeits-Idealismus mindestens 150% zu geben; hervorragende Aussichten darauf selbst auszubrennen inklusive.
Was für eine unaufgeregte Strategie, dem Kapitalismus ein Schnippchen zu schlagen! I’m sold!
---
Mit dieser Kolumne möchten wir gemeinsam mit unseren Freund*innen von Wildling Shoes den Themen Antidiskriminierung, Belonging und Intersektionalität am Arbeitsplatz mehr Raum und Sichtbarkeit geben. Durch Artikel, Interviews und verschiedene Perspektiven wollen wir uns und alle, die im Impact-Sektor arbeiten herausfordern und inspirieren. Und gleichzeitig ermutigen, authentisch gelebte Arbeitsbereiche zu schaffen, die Zugehörigkeit fördern und Diskriminierung reduzieren. Indem wir neue Perspektiven gewinnen und einen gemeinsamen Dialog führen können wir einen kollektiven Schritt in Richtung eines radikalen Systemwandels im Impact-Sektor gehen – von „Macht über“ und „Macht für“ zu „Macht mit“. Unsere Kolumnist*in für das Jahr 2022 ist Sohra Behmanesh.
Sohra Behmanesh lebt mit ihrer Familie in Berlin, arbeitet als freiberufliche Anti-Rassismus-Trainerin und findet Fürsorge und Empathie ebenso großartig wie Intersektionalität.
Hier könnt ihr mehr Artikel aus der Belonging Kolumne lesen: https://www.tbd.community/en/t/to-belonging

Foto: Kris Wolf